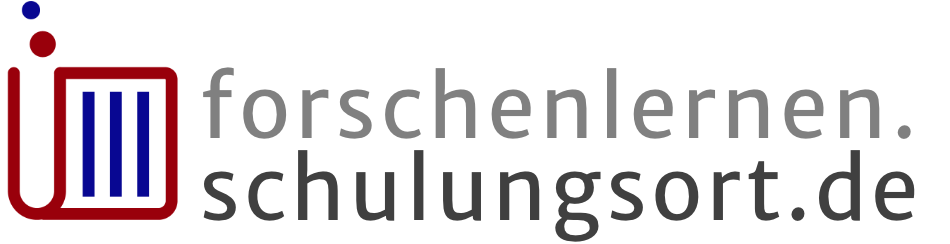Eine Entscheidungsfrage!
Selbst Umfragen durchführen, Daten generieren und sie auswerten – oder auf vorhandene Daten zurückgreifen?
Was ist sinnvoller, welche Vorgehensweise ist wertvoller?
Dauer: 1:15
Transkript des Videos.
Wenn ein Forschender selbst Daten generiert, also eine empirische Erhebung durchführt, bei der gezählt oder gemessen werden muss und bei der die selbst gesammelten Daten aufbereitet und statistisch ausgewertet werden, spricht man von „Primärforschung.“
Wenn dagegen bereits existierende Daten aufbereitet und statistisch ausgewertet werden, ist von »Sekundärforschung« die Rede.
Beide Vorgehensweisen sind als gleichwertig zu betrachten. Denn es ist ja längst nicht jedem möglich, selbst die benötigten Daten zu erheben.
Beispiele für Sekundärforschung:
Wenn etwa Daten über den Verbrauch an pflanzlichen Nahrungsmitteln in Deutschland im Zeitraum des ersten Quartals im Vorjahr benötigt werden, kann der Forschende sie nicht selbst generieren, sondern muss sie bei den entsprechenden Quellen abrufen.
Ein weiteres Beispiel: um die CO2-Bilanz von Lebensmitteln zu veranschaulichen, griff der Ökonom Tobias Hagen auf Daten des Bundesumweltministeriums zurück.

Abbildung: Klimabilanz für Nahrungsmittel (Quelle: Hagen 2014)
Aus seiner Grafik lässt sich ersehen, dass Bio-Nahrungsmittel weniger Klimawirkungen verursachen und dass pflanzliche Nahrung die günstigste Klimabilanz hinterlässt.
Bibliographie
Verwendete Quelle:
Hagen, Tobias (2014): „Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik: CO2-Bilanz von Lebensmitteln“. Abgerufen am 19.01.2015 von http://evidenzbasierte-wirtschaftspolitik.blogspot.de/2014/12/co2-bilanz-von-lebensmitteln.html.
Gedanken dazu.
Also. Lassen Sie uns doch einmal Klartext reden miteinander… Ich gönne mir hier, und zwar ganz in Ihrem Sinne, eine „disruption“, wie zuvor bereits erläutert.
Primäres Forschen im Sinne von eigener Datenerhebung und -auswertung kann nicht der Normalfall sein, wenn es sich um einen Masterabschluss handelt. Beim Bachelorabschluss noch weniger.
Warum?
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens werden selbstverständlich zum Bachelorabschluss benötigt und darum hoffentlich auch im Laufe des Curriculums vermittelt sowie ausprobiert. Hoffentlich…
An empirische Forschungswege wird dort aber meistens noch nicht gedacht – und die lassen sich auch nicht „mal eben“ noch parallel einbringen.
In Masterstudiengängen wird aber meist seitens der Programmverantwortlichen gar nicht mehr ein „Update“, gar „Upgrade“ der Wissenschaftlichkeit ihrer Studierenden angeboten. Hier wäre eigentlich ein „Brückenkurs“ notwendig.
Also, der Schritt zur dezidiert empirischen Forschung wird meist nicht substantiell genug im Curriculum eingebaut – die Programmverantwortlichen stopfen (auch im Masterstudiengang) lieber mehr von ihrem „Stoff“ hinein und vernachlässigen dabei die Methodologie in separaten, übergreifenden Modulen…
Noch schwieriger wird es, wenn man in den Wirtschaftswissenschaften oder auch technischen bzw, naturkundlichen Studiengebieten unterwegs ist. Dort geht es meist primär um quantitative Forschung – also die mit den statistisch auswertbaren Daten.
Es geht dort meist aber weniger um die wertvolle qualitative Forschung – jene mit den rein inhaltlich orientierten Auswertungsmethoden von Meinungen und Bedeutungen, die von Menschen eingebracht werden.
Machen wir uns klar: unsere Vorgehensweise bestimmt bereits die Ergebnisse. Das bedeutet:
Die quantitative Forschung kann immer nur das interpretieren und nutzbar machen, was überprüfbare Zahlen / Daten zuvor geliefert hatten.
Doch die qualitative Forschung kann genau das einbringen, was nicht aus Zahlen gelesen werden kann, sondern aus Aussagen von Menschen, die ihre Meinungen und ihre Erfahrungen einbringen können.
Mitunter benötigt eine Untersuchung daher sogar beide Vorgehensweisen.