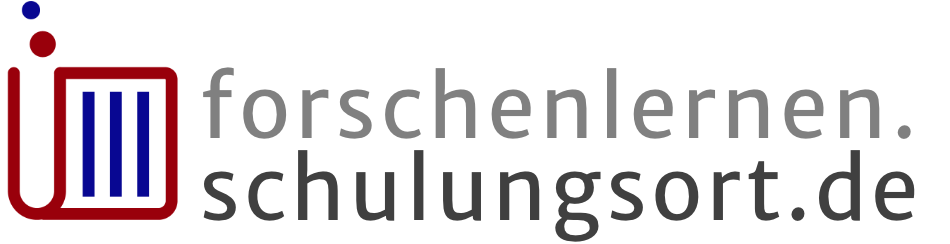Hier kann man wirklich sagen: Alles ist relativ…!
Jetzt erschließen wir uns diese Erkenntnis: Wir lernen beim wissenschaftlichen Arbeiten keine stets inhaltlich wiederholbaren Lösungsschritte, sondern wir lernen eher grundsätzlich und damit übertragbar die Vorgehensweisen zum Ermitteln von Lösungsmöglichkeiten an sich.
Dauer: 4:52
Transkript des Videos
Zuvor hatte Hans-Peter Dürr bereits mit seinem Gleichnis vom Fischernetz deutlich gemacht, welches Paradigma die Wissenschaften bestimmt: Sie suchen nach Wahrheit und wollen allzu gern verbindliche Aussagen darüber machen. Dies liegt nicht nur im Wesen des Forschenden, sondern resultiert oft auch aus den Erwartungen seiner Auftraggeber.
Es legt nahe, dass wir diesen Anspruch einmal näher in den Blick nehmen – und zwar in Art einer durchaus kritischen Betrachtung.
Dazu gehen wir mit dem Psychotherapeuten und Konstruktivisten Paul Watzlawick ins Gespräch und stellen uns den wissenschaftstheoretischen Ansprüchen, die Sir Karl Raimund Popper uns mit auf den Weg des wissenschaftlichen Arbeitens gegeben hat. Wir werden dabei weiteren Paradigmen der Wissenschaft begegnen, mit denen wir vertraut sein müssen.
Überholte Sichtweisen von Wissenschaftsleistungen
Paul Watzlawick hatte in einem Interview an seinem früheren Arbeitsplatz im Mental Research Institute im kalifornischen Palo Alto bereits 1997 zu bedenken gegeben, dass in seinem Fach, der Psychotherapie, immer noch angenommen werde, dass es eine »wirkliche Wirklichkeit« gebe, der sich die sogenannten geistig Normalen und somit vor allem die Therapeuten bewusst seien. Die sogenannten Geisteskranken hätten hingegen eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit.
Diese Auffassung sei in anderen Wissenschaftszweigen seit langem abgeschafft worden und einfach nicht mehr haltbar. In der heutigen Erkenntnistheorie sei es die Aufgabe der Wissenschaft, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam seien. „Das mag sehr wohl bedeuten, dass in fünf Jahren diese heutige, beste Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere abgelöst wird“ (Watzlawick in Gertler 1997c).
Auch diese erkenntnistheoretische Sicht spricht also dafür, nicht generelle und zeitlos gültige Erkenntnisse erzielen zu wollen, sondern sich auf den konkreten und aktuellen Zweck der Lösung eines vielleicht sogar örtlich eingegrenzt bestehenden Erkenntnisproblems zu konzentrieren und sich darauf wirklich zu beschränken.
Wenn wir dieser Sicht von Paul Watzlawick folgen wollen und uns dabei einmal auf mögliche Fragestellungen der Veganomics, der Veganwirtschaft im engeren und im weiteren Sinne einlassen, fragen wir also nicht mehr: Wie können Landwirte bio-vegan anbauen, um zu wirtschaftlichen Erträgen zu gelangen und nicht pleite zu gehen? Oder: Worin unterscheidet sich das Managen eines veganen von dem eines konventionellen Supermarktes?
Wir müssen wegkommen von generellen Antwortversuchen, weil sie nämlich faktisch so gut wie nie möglich sind – wir müssen uns ausrichten auf Lösungsversuche für ganz konkrete und eingegrenzte Herausforderungen.
Bleibt wissenschaftliches Arbeiten dann nicht immer dem Detail verhaftet? Was kann ich denn davon lernen und mitnehmen, wenn ich immer wieder neu die Faktoren und Kriterien für nur einzeln gültige Ergebnisse herausbekommen darf?
Die Antwort darauf möge lauten: Wir lernen beim wissenschaftlichen Arbeiten keine stets inhaltlich wiederholbaren Lösungsschritte, sondern wir lernen die Vorgehensweisen zum Ermitteln von Lösungsmöglichkeiten an sich.
Dem bio-veganen Landwirt, der wirtschaftlich dauerhaft überleben muss, liefern wir also keine Patentrezepte, sondern müssen vertiefend die bestimmenden Faktoren seines Problems herausfinden, um eine für ihn passende Lösung finden zu können. Und dem angehenden Manager eines veganen Supermarktes hilft kein grundsätzliches Manager-Handbuch, sondern nur die in wissenschaftlicher Praxis trainierte Fähigkeit zur Analyse der Konkurrenzsituation, der Bezugsquellen, der Zielgruppen und deren Präsenz in einem zu definierenden Umkreis, und so weiter.
Paul Watzlawick hat uns mit auf den Weg gegeben, dass es die Aufgabe der Wissenschaft sei, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Je mehr und je öfter wir selbst solche Verfahrensweisen als Lösungsangebot entwickeln, umso besser werden wir geschult sein, wissenschaftlich Lösungen zu entwickeln. Genau dafür brauchen wir also immer wieder die eigene Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens, wie sie in der hochschulischen Umgebung durch entsprechende Haus-, Projekt- und Abschlussarbeiten realisiert wird.
Bibliographie
In dieser Lektion verwendete Quelle:
Gertler, Martin (1997c): Wirklichkeit und Wahrheit – Paul Watzlawick. Abgerufen am 24.12.2014 von http://youtu.be/LEmZ2GOxzo8?t=1m39s.
Gedanken dazu.
Das ist doch mal was! Wissenschaft produziert also nicht allgemeingültige Wahrheiten.
Hätten Sie das gedacht?
Ob ja oder nein – ist Ihnen klar, dass das nun auch für Ihr eigenes forschendes Vorhaben gelten wird…?
Paul Watzlawick hat es uns in der Videolektion ja gesagt:
Aufgabe der Wissenschaft ist es, Verfahrensweisen zu entwickeln, die jeweils für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind.
Sie könnten nun daraus folgern, dass auch Sie sich allein auf Ihren eigenen Zweck, auf die Zielsetzung Ihres Forschungsvorhabens zu einem konkreten Fall konzentrieren müssen.
Verallgemeinerungen aufgrund eines Einzelbefundes sind unwissenschaftlich.