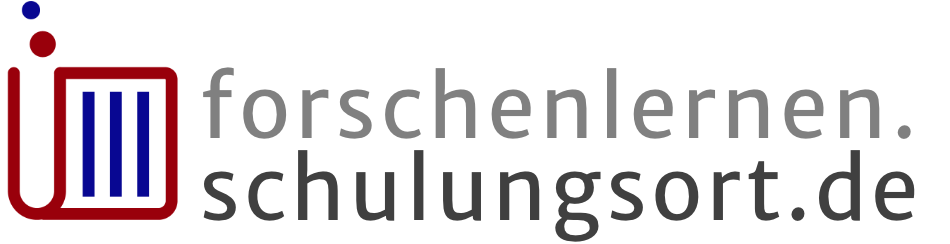Sie haben sich mit grundlegenden Fragen wissenschaftlichen Arbeitens auseinandergesetzt:
- Was ist Wissenschaft?
- Wodurch wird Forschung relevant?
- Welche Haltung braucht es, um wirklich zu neuen Erkenntnissen zu gelangen?
Die folgenden dreizehn Aufgaben laden Sie ein, dieses Verständnis auf Ihre eigene Forschung zu übertragen.
Sie sind konkreter als das Aufgabenblatt vom Anfang, und es kann hilfreich sein für Ihre eigene anstehende wissenschaftliche Arbeit!
Nehmen Sie sich Zeit für die Reflexion – schriftlich, konkret, selbstkritisch.
Tipp:
Kopieren Sie sich den Aufgabenblock in eine Textdatei und bearbeiten Sie darin Ihre Antworten! So können Sie später immer wieder darauf zurückkommen.
Aufgabe 1: Wissenschaftlich – oder nicht?
- Beschreiben Sie Ihr aktuelles Forschungsvorhaben (Thema, grobe Zielsetzung).
- Erläutern Sie, inwiefern es sich dabei um ein wissenschaftliches Projekt handelt – oder noch nicht.
- Was müsste ggf. noch ergänzt oder angepasst werden, damit Ihr Projekt wissenschaftlichen Standards entspricht?
Aufgabe 2: Ihr Erkenntnisziel
- Formulieren Sie das Erkenntnisziel Ihrer Arbeit so präzise wie möglich.
- Grenzen Sie es deutlich von persönlichen, praktischen oder beruflichen Zielen ab.
- Prüfen Sie: Ist Ihr Ziel realistisch erreichbar – mit den vorhandenen Ressourcen?
Aufgabe 3: Relevanz und Forschungsbeitrag
- Welchen Beitrag könnte Ihre Forschung zur Weiterentwicklung des bestehenden Wissens leisten?
- Welche Lücke, welches Problem, welche offene Frage greifen Sie auf?
- Wo wird aus Ihrer Perspektive die Relevanz für eine Wissenschaftsdisziplin sichtbar?
Aufgabe 4: Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage
- Arbeiten Sie die drei Grundelemente wissenschaftlichen Arbeitens heraus:
- Ihre Problemstellung (Was ist das Problem hinter dem Thema?)
- Ihre Zielsetzung (Was wollen Sie herausfinden oder klären?)
- Ihre Forschungsfrage (Was genau wollen Sie wissen?)
- Stimmen diese drei Elemente logisch aufeinander ab?
Aufgabe 5: Methodenkritik und „Maschenweite“
- Überlegen Sie, mit welchen Methoden Sie arbeiten möchten oder bereits arbeiten.
- Reflektieren Sie kritisch: Welche Erkenntnisse werden Ihnen durch diese Methoden (nicht) zugänglich sein?
- Welche „kleinen Fische“ könnten durch Ihr Netz rutschen – und wie gehen Sie damit um?
Aufgabe 6: Konstruktivismus im Blick
- Inwiefern ist Ihnen bewusst, dass auch Ihre Forschung Wirklichkeit konstruiert?
- Wo liegen mögliche blinde Flecken – durch Ihre Perspektive, Ihre Methodik, Ihre Sprache?
- Wie können Sie Transparenz und Reflexivität im Forschungsprozess herstellen?
Aufgabe 7: Falsifizierbarkeit statt Verifikation
- Welche theoretischen Annahmen oder Hypothesen fließen in Ihre Arbeit ein?
- Sind diese prinzipiell falsifizierbar? Falls nicht: Wie könnten Sie sie überarbeiten?
- Was würde eine Widerlegung Ihrer These für Ihre Arbeit bedeuten?
Aufgabe 8: Wissenschaftliche Kommunikation
- Wer sind potenzielle Leser:innen oder Adressat:innen Ihrer Arbeit?
- Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Argumentation nachvollziehbar, überprüfbar und anschlussfähig ist?
- Auf welche Weise pflegen Sie wissenschaftlichen Austausch – innerhalb und außerhalb Ihrer Disziplin?
Aufgabe 9: Disziplinen und Interdisziplinarität
- Welcher wissenschaftlichen Disziplin ist Ihr Projekt zuzuordnen – und warum?
- Welche Denkweisen oder Methoden anderer Disziplinen könnten Ihre Arbeit bereichern?
- Gibt es Chancen oder Risiken bei einem interdisziplinären Zugriff?
Aufgabe 10: Ihre Wirklichkeitskonstruktionen
- Wie definieren Sie (implizit oder explizit) Begriffe wie „Wahrheit“, „Fakt“, „Realität“ in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
- Welche epistemologische Haltung nehmen Sie (bewusst oder unbewusst) ein?
- Welche alternativen Sichtweisen könnten Ihre eigenen Deutungen ergänzen oder infrage stellen?
Aufgabe 11: Objektivität sichern
- Welche Maßnahmen treffen Sie, um Subjektivität zu reflektieren und Objektivität herzustellen?
- Wie dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen im Forschungsprozess?
- Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?
Aufgabe 12: Ihre Haltung als Forschende:r
- Was bedeutet für Sie „forschende Haltung“ – und wie spiegelt sie sich in Ihrer Arbeit wider?
- Wo erleben Sie Spannungen zwischen Ihrem Erkenntnisinteresse und externen Erwartungen (z. B. Betreuer:innen, Institutionen)?
- Wie möchten Sie mit diesen Spannungen umgehen?
Aufgabe 13: Von der Forschung zur Entwicklung
- Gibt es Anwendungsmöglichkeiten Ihrer Forschungsergebnisse – in Theorie, Praxis oder Gesellschaft?
- Wie weit darf oder soll Ihre Arbeit gehen: Erkenntnis, Entwicklung, Handlungsempfehlung?
- Wo liegt die Grenze zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und persönlichem Engagement?
Die Bearbeitung dieser Aufgaben stärkt Ihre wissenschaftliche Selbstreflexion – und bildet die Grundlage für Ihr methodisches Vorgehen, Ihre Einleitungskapitel und Ihre Argumentationsstrategie.
Je klarer Sie Ihre Grundpositionen kennen, desto stärker wird Ihre Forschung wirken.