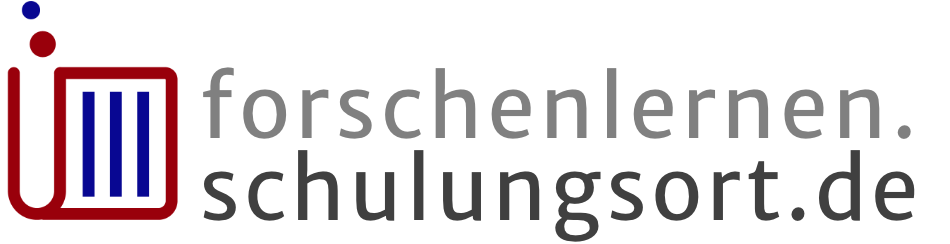Klären wir im Blick zurück auf dieses Kapitel nun nochmals wieder die wichtigsten Infos!
Videolektion, Dauer: 2:26
Transkript des Videos
In diesem Kapitel – lassen Sie es mich jetzt auch wieder zusammenfassen – haben wir uns dem unverzichtbaren Quellenverzeichnis befasst.
Es muss ein Verzeichnis tatsächlich genutzter Quellen sein und nicht etwa, wie man es früher noch handhabte, ein Verzeichnis auch aller Quellen, die man beim Recherchieren mal in die Hand genommen, also benutzt hatte. Längst gilt: das Quellenverzeichnis stellt nur dar, was tatsächlich in der Arbeit und im Anhang verwendet wurde. Es ist insofern vergleichbar zu den Abbildungs- und Tabellenverzeichnissen; sie alle haben ihren Platz im Anschluss an den Anhang, also am Ende der Arbeit.
Noch eine Gepflogenheit früherer Jahre ist inzwischen ausgemustert:
Es gibt nur noch ein Verzeichnis für alle Quellen und man unterscheidet insofern nicht mehr zwischen Literatur (also Gedrucktem) und E-Books und Zeitschriftenartikeln und Online-Quellen und juristischen Quellen. Ein einziges Quellenverzeichnis, alphabetisch sortiert nach Verfassernamen – fertig,
Quellenverwaltungsprogramme wie Zotero machen all das seit vielen Jahren automatisch und richtig, man erkennt die jeweilige Quellenart eh und braucht keine unterschiedlichen Verzeichnisse mehr. Auch sorgt Zotero dafür, dass jede irgendwo im Text vorkommende Quelle im Quellenverzeichnis wirklich vorkommt und dass jede Quelle, die wir im Verlauf des Schreibens der Arbeit wieder aus dem Text entfernen, anschließend auch nicht mehr im Quellenverzeichnis vorkommt.
Die unterschiedlichen Eintragsarten im Quellenverzeichnis haben Sie ebenfalls kennengelernt. Nun wissen Sie beispielsweise, dass Sie je nach Quelle Angaben über Autoren, Herausgeber, Mitarbeiter, Institutionen, Bearbeiter, den Verlagsort und den Verlagsnamen benötigen.
Außerdem haben Sie häufig benutzte Veröffentlichungsarten kennengelernt: Monographien, Sammelwerke, Internetquellen, Gesetzestexte und Gerichtsurteile, Konferenzbeiträge und vieles mehr. Vertiefen Sie sich bei Bedarf einfach noch einmal in die Lektio n zu den Veröffentlichungsarten!
Soweit also der Blick zurück in das Kapitel zum Quellenverzeichnis. Sie werden gemerkt haben, dass dieses Thema ähnlich viel Aufmerksamkeit von uns erfordert wie die Frage nach den Zitierweisen. Das folgende Kapitel macht Ihnen diese Dimensionen anhand eines ausführlich erarbeiteten Fallbeispiels deutlicher.