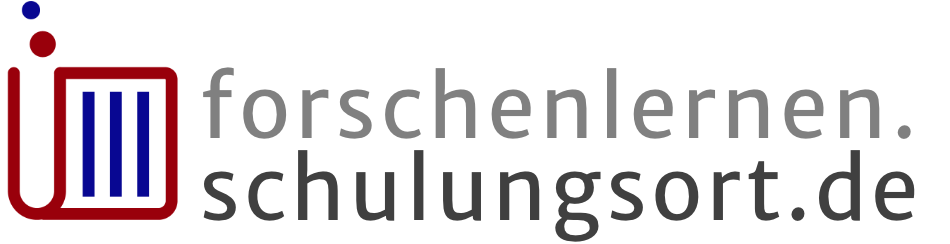Kap. 3: Schritt 2: Der Untersuchungsgegenstand – Studierzeit: ca. 10 Minuten
Lernen Sie an einem konkreten Themenbeispiel, warum in diesem Grundmodell der Wissenschaft kein separates Grundlagenkapitel vorgesehen ist.
Video, Dauer: 5:34
Transkript des Videos
Wo bleibt das Grundlagenkapitel? werden Sie vielleicht fragen. Das muss doch immer nach der Einleitung kommen…?
Womöglich sind Sie es so gewohnt.
Mein Einspruch dagegen: die in vielen Gliederungen in Kap. 2 noch immer üblichen „konzeptionellen Grundlagen“ (als eigenständiges Kapitel) sind für eine tatsächlich wissenschaftliche Arbeit unbrauchbar, da kontraproduktiv: Denn dort wird in der Regel möglichst vollständiges lexikalisches Wissen versammelt.
Nun gut, manche Prüferinnen und Prüfer bewerten Arbeiten auch in dieser Hinsicht.
Bei näherem Hinsehen haben solche Blöcke aber eigentlich gar keinen Platz in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die ja doch nur eines zu schaffen hat: das Erkenntnisziel zu erreichen!
Wenn wir wissen, dass wir einen Roten Faden brauchen, dann sollten wir dem auch folgen, sobald wir ihn kennen, und keine Exkurse einbauen, die nicht zielführend sind!
Ich erläutere Ihnen das einmal an einem Beispielthema: „Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zur Transaktionskostensenkung bei einem mittelständischen Unternehmen“
Klären wir erst einmal kurz die Bestandteile dieses Titels. Hier ist die Blockchain-Technologie die unabhängige Variable (UV), also nicht der Untersuchungsgegenstand – daher gehört sie auch nicht in diesem Schritt 2 vorgestellt!
Hingegen ist das Unternehmen mit den genannten Anwendungsfeldern, also hinsichtlich der Transaktionskosten, der Untersuchungsgegenstand. Wie in der vorherigen Lektion beschrieben, ist der Untersuchungsgegenstand also hier in Schritt 2 zu behandeln.
Würde nun stattdessen solch ein lexikalisches Grundlagenkapitel nach der Einleitung folgen, was würden Sie darin alles unterbringen wollen? Ob Sie nun sogenannte „konzeptionelle“ oder „definitorische“ Grundlagen zusammenstellen möchten – hier hätten Sie reichlich zu tun, denn zu erläutern wäre darin:
1. die Blockchain-Technologie und
2. Transaktionskosten bei mittelständischen Unternehmen.
Um die Blockchain-Technologie an sich zu beschreiben, würden Sie mindestens 40 Textseiten schreiben müssen. Und um Transaktionskosten bei mittelständischen Unternehmen verständlich zu machen, wären es mindestens 20 weitere Textseiten. Für beides brauchen Sie nicht nur diesen Platz, sondern auch eine Menge Zeit.
Solche Grundlagen-Ambitionen machen oft 60 Prozent an einer Arbeit aus. Doch wozu das alles? Was tragen Grundlagenkapitel denn zur eigentlichen Untersuchung, also zur Problemlösung bei? Wenig bis nichts!
Hinzu käme ja dann auch noch die Vorstellung der Arbeitsweisen des konkreten mittelständischen Unternehmens. Denn wenn Sie das Unternehmen eher „allgemein“ sehen wollten, dann wäre ja gar nichts zu untersuchen! Für eine Untersuchung brauchen Sie etwas Konkretes, das gemessen und befragt werden kann.
Heraus käme also: ein Essay, also ein Aufsatz. Wenn Sie nicht daran gehen an das, was zu untersuchen ist.
Fazit: Grundlagenkapitel können zu einer echten Sackgasse werden!
Natürlich braucht jede wissenschaftliche Arbeit auch Grundlagenanteile, aber die müssen dem eben genannten „Roten Faden“ folgen! Also: dort einbringen, wo sie konkret benötigt werden, um die erkannte Problemstellung zielführend zu lösen.
Ein Alltagsbeispiel, also wirklich aus dem Alltag jetzt einmal: Wenn Sie eine neue Küche geplant bekommen wollen und ins Einrichtungsgeschäft gehen, möchten Sie auch nicht sich anhören müssen, was die Küchen dieses Betriebes alles können und auf welchen Grundlagen der Betrieb arbeitet, seit wann es ihn schon gibt und überhaupt, in der dritten Generation… – sondern Sie wollen doch erst einmal Ihren Bedarf – also Ihre Problemstellung – und Ihre räumlichen Verhältnisse und Ihr verfügbares Budget einbringen, um dann zu erfahren, was man Ihnen dazu passend als Lösung anbietet.
Solch ein Grundlagenkapitel über die Firma und ihre Produkte und ihre Geschichte und so weiter an sich, das wollen wir auch im Alltag nicht erleben, es ist nicht zwingend notwendig, es sei denn da, wo wir nachfragend dann mehr erfahren könnten.
Tipp: Nutzen Sie unsere FAQ, zum Thema Grundlagenteil z. B. diesen Eintrag, und ich zitiere ihn hier einfach:
„Beginnen Sie Ihren Bearbeitungsteil direkt mit Kap. 2 und bringen Sie Grundlagen-Informationen immer direkt dort ein, wo sie gerade für Argumentationen oder für die Nachvollziehbarkeit notwendig sind! Auf diese Weise vermeiden Sie die unnütze Erarbeitung und Verschriftlichung von nicht benötigten Informationen, Sie sparen Zeit und Kraft – und Ihre wissenschaftliche Arbeit gewinnt an Konsistenz.
Grund für diese Vorgehensweise ist, den forschenden Charakter – Erreichen eines Erkenntnisziels … in allen hochschulischen Arbeiten, also auch bei Projektarbeiten und Referaten, durchgängig aufrecht zu erhalten.“
Quelle: forschenlernen.jetzt, FAQ: Wie tiefgehend muss der Grundlagenteil sein?
Wenn Sie es jedoch gewohnt sind, immer erst einmal die Grundlagen zu sammeln, können Sie sich diese Ihre Sammlung – wenn auch in eingeschränktem Maße – durchaus nutzbar machen: Erfassen Sie diese Grundlagen für sich selbst parallel zur Arbeitsdatei in einer Extradatei, um Bestandteile daraus nach Bedarf und nur dann und nur dort einzusetzen im Laufe der Arbeit, wo sie tatsächlich benötigt werden.
Was vielmehr benötigt wird, ist der aktuelle Forschungsstand zur Problemstellung! Doch der kann erst sinnvoll eingebracht werden, wenn Ihr Untersuchungsgegenstand hinsichtlich seiner Problemstellung hinreichend beschrieben worden ist. Daher folgt gleich genau das in Schritt 3 unseres Modells: Forschungsstand und Methodologie!