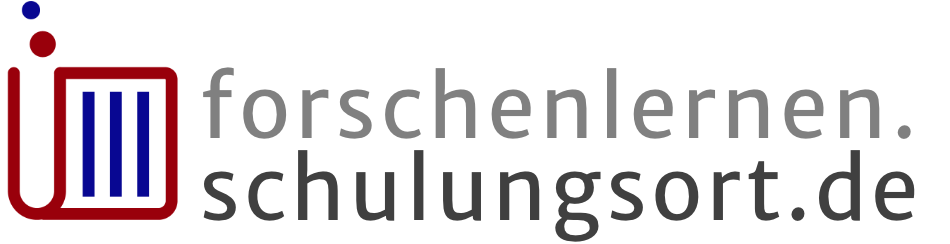In diesem Abschnitt werden Sie lernen, warum der Untersuchungsgegenstand direkt nach der Einleitung beschrieben werden muss.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, warum Sie hier nicht das oftmals übliche Kapitel zu konzeptionellenGrundlagen einbringen, sondern wie Sie sich Ihre gewohnte Grundlagensammlung wesentlich hilfreicher zunutze machen können.
Sie lernen in diesem Abschnitt nun die Anforderungen an Ihren Untersuchungsgegenstand kennen. Nur wenn er sie erfüllt, kann er untersucht werden.
Video, Dauer: 4:59
Transkript des Videos
In diesem Kapitel werden Sie lernen, warum der Untersuchungsgegenstand direkt nach der Einleitung beschrieben werden muss. Danach erfahren Sie, warum Sie an dieser Stelle Ihrer Gliederung genau nicht das oftmals übliche Kapitel zu konzeptionellen Grundlagen einbringen, sondern wie Sie sich Ihre gewohnte Grundlagensammlung wesentlich hilfreicher zunutze machen können.
Vorab: es geht um
• einen konkreten und prüfbaren Untersuchungsgegenstand – also bitte keine allgemeinen Zustände, und ganz sicher kein „Fallbeispiel“.
• Wir müssen ihn aus der Perspektive der Problemstellung und der Zielsetzung beschreiben, nicht einfach so – etwa geschichtlich oder ökonomisch.
• Empirische Bestandteile – nämlich alle erhaltenen Daten und Auskünfte oder Angaben – müssen wir methodisch korrekt einbringen.
Was genau ist denn der Untersuchungsgegenstand? Er wird in der Regel erkennbar in der abhängigen Variablen in Ihrer Themenstellung.
Ich möchte Ihnen das jetzt einmal deutlich machen an einem Beispielthema.
„Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zur Transaktionskostensenkung bei einem mittelständischen Unternehmen“ – hier ist die Blockchain-Technologie die unabhängige Variable (UV), denn sie ist so wie sie ist…, und das Unternehmen bildet die abhängige Variable (AV), denn dort muss untersucht werden, inwiefern diese Technologie zum Anwendungsziel passen könnte.
Also ist das Unternehmen mit seinem möglichen Anwendungsfeld der Transaktionskosten der eigentliche Untersuchungsgegenstand und gehört daher ins 2. Kapitel, nicht aber die Zusammenfassung der Blockchain-Technologie.
Hinweis: Am Schluss unseres Kurses erleben Sie die Umsetzung dieses Beispielthemas in ein Gliederungsbeispiel. Dort erfahren Sie Punkt für Punkt, wie die Gliederung exakt dem Grundmodell folgt – und warum und wie sie dennoch „schlanker“ ausgefallen ist.
Es geht übrigens beim Gegenstand einer Untersuchung nie um ein „Fallbeispiel“…! Das Wort „Fallbeispiel“ führt in die falsche Richtung und gehört daher weder in den Titel noch den Text einer wissenschaftlichen Arbeit.
Ein Alltagsbeispiel dazu: Stellen Sie sich vor, Ihr Hausarzt untersucht Sie wegen Ihrer Halsschmerzen und betrachtet Sie dann als Fallbeispiel für alle anderen, die heute noch in die Praxis kommen und über Halsschmerzen klagen – keine nähere Untersuchung mehr, sondern gleiche Diagnose ins Patientenblatt eintragen und allen nachfolgenden die gleichen Medikamente verschreiben… Fazit: „Fallbeispiel“ geht gar nicht.
Formulierungen, die auch schon vielleicht im Titel der Arbeit von einem „Fallbeispiel“ ausgehen, sind somit hoch problematisch, denn ein Fallbeispiel stünde ja für etwas anderes: etwas Allgemeingültiges. Der Einzelfall soll für alle anderen Fälle gelten…? Nein.
Wir werden in wissenschaftlichen Arbeiten in der Regel keine allgemeingültigen Antworten finden und geben können. Daher: bitte stets Konkretes als Untersuchungsgegenstand wählen, es konkret beschreiben, und prüfbar muss das Ganze sein! Unser Untersuchungsgegenstand muss von uns mit wissenschaftlichen Mitteln prüfbar sein.
Und aufgrund der benötigten Problemstellung muss dieser Untersuchungsgegenstand mit einem Manko – da fehlt etwas – oder einem Defizit oder einem Konflikt behaftet sein.
Da können vielleicht Rechtsnormen in Konflikt stehen oder es werden irgendwelche Ziele nicht erreicht oder aber ein Design von irgendeinem Auftritt in der Öffentlichkeit oder im Selbstverständnis (Corporate Identity) ist vielleicht nicht hinreichend…
All diese Dinge können also in Verbindung mit der Problembeschreibung den Untersuchungsgegenstand erläutern und darum wird es gehen in diesem zweiten Schritt unserer wissenschaftlichen Arbeit.
Erforderlich ist es dafür, dass wir zu unserem Untersuchungsgegenstand nicht auf Abstand bleiben müssen – also sozusagen nur über ihn etwas schreiben können. Wir benötigen von ihm Daten und Fakten und am besten auch direkte Nachfragemöglichkeiten.
Wir werden unseren Untersuchungsgegenstand auch nicht „an sich“, sondern unbedingt nur mit Blick auf das festgestellte Problem vorstellen. Sonst würden nämlich Seiten um Seiten mit Infos gefüllt, die zum Lösungsweg gar nicht benötigt werden.
Also, überlegen Sie sich auch zu Ihrer Themenidee oder Ihrem Vorhaben bereits nicht nur, was Sie untersuchen werden, sondern auch: wen Sie deshalb untersuchen werden! Mit „wen“ meine ich einen Gegenstand oder eine Person oder eine Gruppe oder eine Organisation oder ein Unternehmen. Und die lassen sich nur untersuchen, wenn sie sich tatsächlich selbst untersuchen lassen, also wenn die sich messen lassen oder befragen lassen, wenn sie Ihnen Auskunft geben bzw. wenn Sie hinreichend Daten und Auskünfte von anderer Seite erhalten.
Ohne einen Untersuchungsgegenstand, der sich wirklich untersuchen lässt, gibt es keine Untersuchung, sondern allenfalls Behauptungen, also einen Aufsatz!