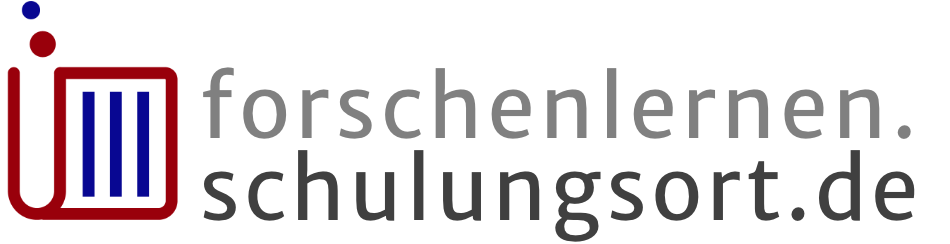In dieser Lektion lernen Sie an Beispielen die gängigen Schwächen und Stärken von bereits eingereichten Problemstellungen kennen.
Da bei greifen wir die zuvor besprochenen Themenformulierungen auf.
Video, Dauer: 3:13
Transkript des Videos
Jetzt zum Thema Problemstellung. Die muss vor allen Dingen nachvollziehbar sein. Also sie muss man transparent machen in seiner Einleitung, was da wirklich das Problem sein soll, um das man sich kümmern will.
Es ist sicher noch etwas allgemeinerer Art, aber von einem konkreten Sachverhalt ausgehend und soll inhaltlich beschreiben, das als Problem auch annehmbar wäre und auch lösbar wäre. Das muss begründet werden im Einleitungskontext zur Problemstellung, warum es sich um ein zu lösendes Problem handelt.
Bitte belegen Sie dann aber auch, dass das Problem zuvor noch nicht gelöst worden ist, denn sonst brauchen wir nichts mehr zu untersuchen, wenn die Wissenschaft da schon eine Lösung gefunden und angeboten hat. In der Regel ist das aber im konkreten Fall ja noch nicht gegeben oder es stellt sich die Frage, Problemstellung, oder man erkennt auch, dass vielleicht vorhandene Rezepte oder schon begangene Wege nicht genutzt und nicht gefruchtet haben.
Dann gibt es natürlich schon einen Grund zu der Untersuchung, die dann ihre ganz eigene Antwort finden wird, ihre ganz eigene Erkenntnis, ihr eigenes Wissen generiert.
Schauen wir dazu nun auch, was denn da so an Ausschnitten vorhanden ist:
„Einfluss des Römischen Rechts auf die Entstehung des Darlehensvertrags“, das hatten wir eben.
Dazu wurde als Problemstellung formuliert: „Das Bürgerliche Gesetzbuch ist in Deutschland nicht mehr wegzudenken, es regelt den Alltag des Zusammenlebens, insbesondere Vertragsrecht ist wichtig, da bei den meisten Handlungen bewusst oder unbewusst Verträge abgeschlossen werden, allerdings bringen Verträge und Vertragsinhalte Rechtsstreitigkeiten mit sich, daher wird in dieser wissenschaftlichen Arbeit untersucht, inwiefern der Rechtsgelehrte Savigny, welcher Vertreter der Historischen Rechtsschule ist, die Entstehung des Vertragsrechts durch das Römische Recht beeinflusst hat.“
Problemstellung…? Was ist da nun die Problemstellung…?!?
Da gibt es solch ein „…allerdings bringen Verträge und Vertragsinhalte Rechtsstreitigkeiten mit sich“ – aber das hat ja nichts mit dem Einfluss der Römischen Rechts auf die Entstehung des Darlehensvertrags zu tun.
Da schreibe ich dann daneben in rot: ? Problemstellung ?.
Sie wird so nicht erkennbar.
„Potenziale von Facebook Commerce als Verkaufsplattform für Nischenprodukte“
– eben vorgestellt als Thema. Die Problemstellung: „In der Vergangenheit wurden Onlineshops innerhalb von Facebook bereits am Massenmarkt getestet, es gibt jedoch noch keine Erfahrungen in Deutschland dazu, inwieweit sich Onlineshops innerhalb von Facebook in Nischenmärkten wie denen veganer Produkte etablieren können.“
Mit Quellenangabe versehen – auch das ist wichtig: immer von vornherein schon in der Einleitung auch klar zu machen: Wir lügen uns nicht was vom Himmel runter, sondern machen überprüfbar, in dem wir auf Quellen verweisen, wo diese Informationen nun her stammen.
Eine klare Problemstellung!
Es gibt noch keine Erfahrungen in Deutschland dazu, inwieweit sich oder inwiefern sich Onlineshops innerhalb von Facebook in solchen Nischenmärkten etablieren können.
Mit anderen Worten: erstmalig jetzt erforscht an einem kleinen Beispiel.
Gedanken dazu.
Die Hinweise zur Formulierung von Problemstellungen in der ersten Minute der Lektion halte ich für enorm wichtig.
Notieren Sie sich am besten die Stichpunkte:
• Sie muss nachvollziehbar sein
• Allgemeiner Art, von einem konkreten Sachverhalt ausgehend
• Inhaltlich etwas beschreiben, das als Problem annehmbar wäre
• Begründen, warum es sich um ein zu lösendes Problem handelt
• Belegen, dass das Problem zuvor noch nicht gelöst worden ist