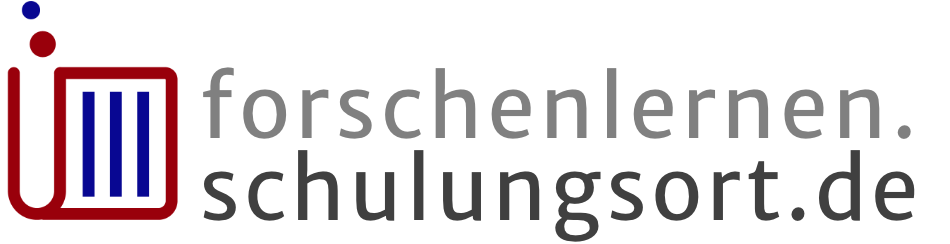Kapitel 2: Forschen realisieren – Studierzeit: ca. 10 Minuten
Eine Einschätzungshilfe
In der Regel sind die Ergebnisse einer guten wissenschaftlichen Untersuchung sinnvoll, vor allem wenn sie für ein Praxisproblem erhellend und daher hilfreich ist.
Darauf gilt es sich zu richten, wenn es um eine Themenstellung geht, die man sich selbst setzen kann – nicht erst bei Abschlussarbeiten, sondern auch bereits bei Hausarbeiten.
Dauer: 5:11
Transkript des Videos
Wenn die wissenschaftliche Arbeit schließlich fertiggestellt ist, stellt sich oft eine wohltuende Zufriedenheit beim Verfasser ein, denn er hat das Gefühl, einen wichtigen, brauchbaren und guten Beitrag erstellt zu haben.
Die Befriedigung darüber resultiert auch großenteils aus dem Ergebnis, von dem man nun glaubt, dass es eine große Bedeutung habe. Man ist zuversichtlich, etwas Neues und Allgemeingültiges erkannt und seiner Mitwelt übergeben zu haben.
Dazu ist ein Erinnern an das Video zum Fischernetz-Gleichnis von Hans-Peter Dürr empfehlenswert. Dürr relativierte darin die Bedeutung der Erkenntnis, indem er gleichnishaft verdeutlichte, dass alle unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ergebnisse allein durch die Wahl unserer Methoden und Instrumente bestimmt sind, folglich keine allgemeingültigen Aussagen daraus resultieren können. (Vgl. Hans-Peter Dürr in Gertler 1997b von 22:30 bis 24:22)
Mindert das den Wert der wissenschaftlichen Arbeit? Nein – denn wer mit diesem Bewusstsein forscht, weiß, dass er in jedem Falle einen aktuellen Beitrag zur Wissenschaft und hoffentlich auch zum Wohl der Mitmenschen leistet.
Ob sich dieser sein Beitrag bewährt und für wen er tatsächlich nutzbringend werden kann, das bleibt abzuwarten und macht das Forschen letztlich wirklich spannend.
In der Regel sind die Ergebnisse einer guten wissenschaftlichen Untersuchung sinnvoll, vor allem wenn sie für ein Praxisproblem erhellend und daher hilfreich ist.
Darauf gilt es sich zu richten, wenn es um eine Themenstellung geht, die man sich selbst setzen kann, wie etwa bei Abschlussarbeiten, aber oftmals auch bereits bei Hausarbeiten. Die gewonnen Ergebnisse sollen dann für etwas nützlich sein.
Gerade Problemstellungen aus den Bereichen der noch jungen Veganwirtschaft liegen auf dem Tisch und sind auch sehr spannend. Denn plötzlich funktionieren einige bisherige sogenannte Grundgesetze der Ökonomie nicht mehr. Sondern es geht um das Vermeiden und Ersetzen von Bestandteilen tierlichen Ursprungs in nahezu allen Wertschöpfungsbereichen, von der Ernährung – in Herstellung, Produktion und Vertrieb – bis hin zur Kleidung, zu Körperpflegemitteln, zu Gegenständen des alltäglichen Bedarfs, zum Reisen…
Darauf richten sich längst auch große Anbieter all dieser Bereiche. Sie benötigen für die Ansprüche ihrer zunehmenden veganen Kundschaft passende Angebote – Forschung wird dazu eingesetzt, um zu diesem Ziel nutzbare Vorgaben zu erfahren, und Entwicklung folgt dann jener Forschung bei der Vorbereitung der Umsetzung.
Insofern tragen immer mehr wissenschaftliche Arbeiten dazu bei, für solche Praxisziele forschend Vorbereitendes beizusteuern.
Daher haben alle noch so kleinen wissenschaftlichen Arbeiten eine besondere Bedeutung, die sich auf diese Herausforderungen einlassen und Ergebnisse liefern, nämlich: neues Wissen schaffen.
Mitunter stellt sich dann aber eine große Enttäuschung ein, wenn die wissenschaftliche Arbeit unerwartet schlecht bewertet wird, und man fragt sich: Wieso kann meine Arbeit wegen Formulierungen, Formaten und unzureichender Wissenschaftlichkeit schlecht bewertet werden?
Unwissenschaftliche Sprache und unzureichender Einsatz wissenschaftlicher Formen und Vorgehensweisen können angesichts der Anforderungen an hochschulische »wissenschaftliche Produkte« – das sind z. B. Hausarbeiten, Referaten, Projektarbeiten, Abschlussarbeiten, eigentlich alle zu prüfenden Einreichungen an Hochschulen – zu einer schlechten Bewertung und selbstverständlich auch zum »Durchfallen« führen, ungeachtet fachinhaltlicher Aspekte.
Das Wesentliche eines wissenschaftlichen Produkts ist das Zustandekommen mit Hilfe der Wissenschaftlichkeit. Daher ist die Einhaltung der wissenschaftlichen Qualitätskriterien und der wissenschaftlichen Methoden unverzichtbar. »Fachpraktische« Zusammentragungen und Erläuterungen allein machen ja noch keine wissenschaftliche (also forschende) Leistung aus – diese wird aber in allen Prüfungsordnungen aller Hochschulen in Deutschland explizit gefordert. Das kann auch gar nicht anders sein, denn schließlich vergeben Hochschulen wissenschaftliche Abschlüsse; ihre Masterabschlüsse müssen zudem zur Promotion befähigen. Ob sie das tun, wird durch die regelmäßigen Akkreditierungen überprüft – es sind also nicht nur die Studierenden, die bewertet werden und den landes- und bundesweiten Anforderungen gerecht werden müssen.
Diese Anforderungen gelten für Universitäten und Fachhochschulen gleichermaßen, denn ihre Abschlüsse sind (im Gegensatz zu früheren Diplomen etc.) gleichgestellt und alle Studienangebote werden in Deutschland auch gemäß identischen Kriterien geprüft und akkreditiert. Das ist nicht in allen Ländern Europas der Fall.
Fachinhaltliche Arbeiten sind notwendiger Bestandteil des Studiums. Sie können an Hochschulen jedoch nur bestehen, wenn sie gemäß den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeitsformen und gemäß den wissenschaftlichen Qualitätskriterien verfasst worden sind.
Bibliographie
Verwendete Quelle:
Gertler, Martin (1997b): „Hans-Peter Dürr: Das Geistige ist die treibende Kraft“. Abgerufen am 25.12.2014 von http://youtu.be/lrgQakHPRP8.
Gedanken dazu.
Welche Bedeutung erwarten Sie von den Ergebnissen, die Ihr wissenschaftliches Vorhaben voraussichtlich präsentieren wird?
Rechnen Sie damit, dass Sie damit die Welt verändern könnten – oder eher nicht?
Sollen sie so ausfallen, dass Sie dadurch schneller Karriere machen könnten im Berufsleben oder in der Politik oder in den Schlagzeilen?
Ich vermute, dass Sie die Frage nach der Bedeutung Ihrer Ergebnisse schon gestellt haben, sie aber noch nicht beantworten können.
Das wäre auch gut so. Denn sonst würden Sie sich selbst womöglich unter Druck setzen und gar nicht mehr ergebnisoffen forschen können.
Die Bedeutung könnte und sollte darin liegen, dazu beigetragen zu haben, auf Basis vorhandenen Wissens durch einen klaren Forschungsweg ein Stück neuen Wissens generiert und den Menschen, der Mitwelt gegeben zu haben…