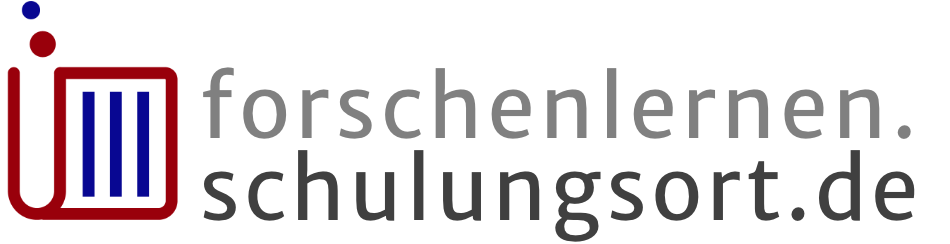Kapitel 1: Forschen verstehen – Studierzeit: ca. 15 Minuten
Wir können nie etwas verifizieren…!
Sir Karl Raimund Popper steht im Mittelpunkt dieser Videolektion.
Er hat mit seinen Arbeiten wesentliche Beiträge zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie geleistet und kritisierte eine gängige Wissenschaftsvorstellung, nach der aufgrund von konkreten Beobachtungen verallgemeinernd Schlüsse für wissenschaftliche Theorien gezogen werden.
Dauer: 5:59
Transkript des Videos
Sir Karl Raimund Popper hat mit seinen Arbeiten wesentliche Beiträge zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie geleistet. Er kritisierte eine gängige Wissenschaftsvorstellung, nach der aufgrund von konkreten Beobachtungen verallgemeinernd Schlüsse für wissenschaftliche Theorien gezogen werden.
Nehmen wir als Beispiel die durch unsere tägliche Praxis genährte Alltags-„Erkenntnis“, besser gesagt: alltägliche Vorstellung, dass wir Menschen »von Natur aus« auf Nahrung tierlicher Herkunft angewiesen seien. So waren wir meist aufgewachsen, programmiert mit Slogans wie „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“ und „Milch macht müde Männer munter“. Folglich besteht bei vielen Zeitgenossen der unverrückbare Glaube, ohne solche Nahrung ginge es nicht, denn sonst würde man auf jeden Fall bald krank werden und verfrüht sterben.
Auch die Mehrzahl der Mediziner und Ernährungswissenschaftler hängt noch dieser Idee einer notwendigen Ernährung mit tierlichen Bestandteilen an. Sie alle hatten einst ihre wissenschaftlichen Ausbildungen genossen und wurden dort mit dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand geprägt, der die sogenannte Mischkost als gesund und notwendig bezeichnet.
Das Mantra von der gesunden Mischkost lebt also auch von wissenschaftlichen Ergebnissen, selbst wenn der heutige Wissensstand dieses Denken inzwischen als überholt gelten lässt.
Hatten wir eben noch von Paul Watzlawick gelernt, dass vieles Wissen nach einiger Zeit durch neue Erkenntnisse und Untersuchungen überholt ist, lernen wir jetzt bei Karl Popper eine weitere kritische Sicht zum Umgang mit wissenschaftlich gestützten Theorien kennen. Er lehnte bereits vor Jahrzehnten grundsätzlich alle induktiv (auf Beobachtungen basierend) erstellten Theorien als unsichere Spekulationen ab und forderte, dass sie durch Suche nach ihnen widersprechenden Beobachtungen umzustoßen seien.
Dies wird recht einfach nachvollziehbar am Beispiel der Behauptung, alle Schwäne seien weiß. Eine solche Behauptung kann nur solange Bestand haben, bis der erste schwarze Schwan gesichtet wird. Und als der erste schwarze Schwan überprüfbar auftauchte, wurde die bisherige Theorie der stets weißen Schwäne selbstverständlich sogleich „falsifiziert“, also als falsch erkannt und verworfen.
Zurück zu unserem zuvor gewählten Beispiel – zu der Behauptung, Menschen benötigten Nahrung tierlicher Herkunft. Diese als Wissen bezeichnete Behauptung wird derzeit bereits in mehr als einer Million Fällen in Deutschland tagtäglich widerlegt – denn 1,5 Prozent der Menschen in Deutschland lebten im Jahr 2015 bereits vegan, also ohne Nahrungsmittel tierlicher Herkunft oder Bestandteile (vgl. veganomics.de 2014).
Die mit viel Förder- und Forschungsgeldern untermauerte Theorie von der Notwendigkeit einer Ernährung mit tierlichen Bestandteilen wurde also damit längst durch den für jedermann beobachtbaren Alltag falsifiziert.
Damit ist allerdings noch lange nicht gesagt, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland solch eine eindeutig überholte und widerlegte Theorie wie die von der Notwendigkeit tierlicher Nahrungsbestandteile umgehend verwerfen würde – im Gegenteil. Wir erleben es in vielen Bereichen unseres Alltags, dass frühere Theorien offenbar nicht stimmen: in den Bereichen Ökonomie, Ökologie, Politik, Gesundheit. Dennoch halten viele Menschen mitunter sehr energisch an längst überholten und widerlegten Ideen und Theorien fest.
Von Sir Karl Raimund Popper nehmen wir also eine grundsätzlich kritische Einstellung mit: Überprüfe stets, was behauptet wird – und sei sogar dazu angespornt, nach allem zu suchen, was jener Behauptung widersprechen könnte! Einfach deswegen, damit nicht aus bloß behaupteten, beobachtungsgestützten Sachverhalten angeblich „gültige“ Theorien werden, denen dann keiner mehr widersprechen mag. Einfach deswegen, damit nicht falsche „Wahrheiten“ bestehen bleiben – unter Hinweis auf ihre zu früheren Zeiten noch mögliche – jedoch vorläufige – Bestätigung.
Hinzu kommt der Hinweis von Popper, dass sich nichts „verifizieren“ lässt – also für immer und ewig als wahr erklären. Denn wir können für jetzt und für die Zukunft grundsätzlich keine Situation ausschließen, die der zuvor verfassten Theorie widerspricht.
Also: wir können und sollen falsifizieren – aber wir können und sollen nicht verifizieren wollen. Solange es (noch) nicht gelungen ist, eine Behauptung oder gar Theorie zu falsifizieren, gilt sie gemäß Popper keinesfalls als verifiziert, sondern nur als „vorläufig bestätigt“. Das Ergebnis „verifiziert“ kann es demzufolge und logischerweise niemals geben.
Die Theorie, unsere Ernährung benötige zum Erhalt unserer Gesundheit tierliche Bestandteile, ist – um es gemäß der Herangehensweise von Sir Popper zu resümieren – schon seit Jahrzehnten nicht mehr „vorläufig bestätigt“, sondern längst widerlegt, „falsifiziert“. Sie stimmt also nicht; solche Behauptungen sind nach heutigem Wissen eindeutig falsch.
Warum ist das für uns wichtig? Weil es seit Popper zu den selbstverständlichen Aufgaben eines jeden Wissenschaftlers zählt, einmal – und es reicht wirklich einmal – widerlegte Behauptungen und Theorien nicht weiterhin zu nutzen, sondern zu verwerfen. Diese Widerlegungen ausfindig zu machen und zu berücksichtigen, gehört zu den Prinzipien unseres wissenschaftlichen Arbeitens.
Damit sollte nach Watzlawick nun mit Popper ein weiteres Mal deutlich geworden sein, wie wichtig für uns selbst eine beständige Praxis wissenschaftlichen Arbeitens ist: Sie schützt uns davor, „Allgemeinplätze“ für wahr und richtig zu halten, und sie motiviert uns für die Suche nach Untersuchungen, die Behauptetes mit dem Ziel der Falsifizierung überprüft haben. Dies bewahrt uns davor, mit ungültigen Theorien untaugliche Lösungen zu verursachen. (Lesetipp: Popper 1966)
Bibliographie
In dieser Lektion verwendete Quellen:
Popper, Karl R. (1966): Logik der Forschung. Tübingen: Mohr (Siebeck).
Veganomics.de (2014): „Studie: Bereits 1,5 Prozent Veganer“. veganomics.de. Abgerufen am 06.09.2014 von http://veganomics.de/aktuelles/meldungen/20140312.php.
Gedanken dazu.
Womöglich haben Sie eben den Kopf geschüttelt.
Wir sollen nicht etwas beweisend zusammentragen, wie man es noch immer und oft macht, auch an den Hochschulen – sondern alles mit dem Ehrgeiz analysieren, es zu „falsifizieren“, also für ungültig zu beurteilen…?
Harter Tobak.
Wenn Sie sich in die Gedanken von Popper eingelassen haben, könnte es Ihnen aber auch einleuchten.
Auch wenn etwas als momentan bestätigt gilt, könnte ja noch heute jemand einen Weg gefunden haben, das als bestätigt Akzeptierte (und damit meist als „wahr“ und „richtig“ Geglaubte) zu falsifizieren, also zu widerlegen.
Ja, und das könnte Ihren Sportsgeist wecken: Ich will nicht mehr behaupten (wie in Aufsätzen / Essays), sondern etwas kritisch prüfen, am liebsten mit der Chance, es zu widerlegen.
Doch – nein, das geht nicht, sagen Sie nun. Denn Sie wollen womöglich etwas verproben, das für Ihren Job, Ihren Auftraggeber oder Kunden relevant ist. Und solche Leute wollen nur positive Botschaften angereicht bekommen…
Welche Lösungen könnte es dann geben…?